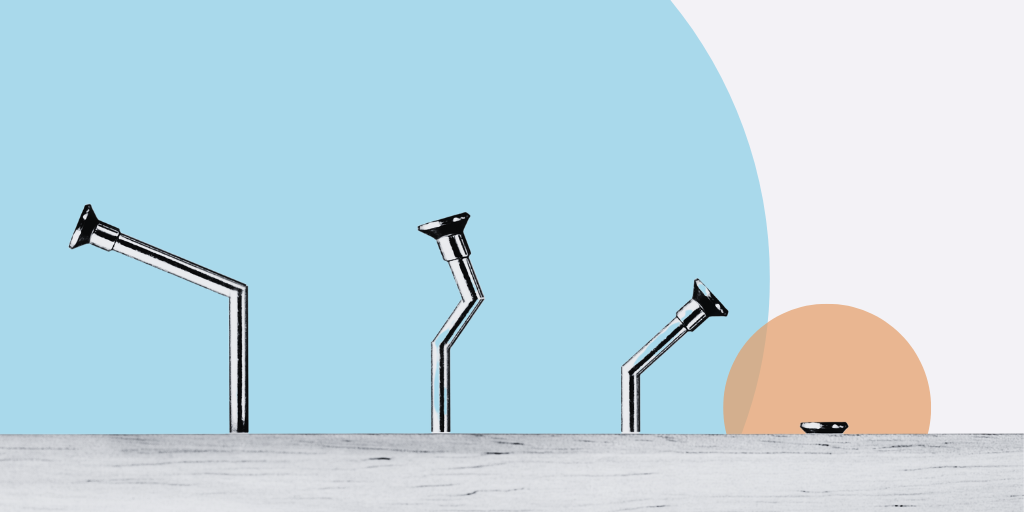Misserfolge im Change
Veränderungsprojekte misslingen häufig. Studien liefern dafür gute Gründe. Doch worauf führen Change-Verantwortliche selbst ihr Scheitern zurück? Dieser Beitrag versammelt anonymisierte Stimmen, die ungeschminkt von ihren Pleiten berichten: Fuck-ups.
Wer immer dafür wirbt, dass Change-Projekte nicht ohne professionelle Unterstützung gelingen, verweist auf einschlägige Studien. Die belegen in schöner Regelmäßigkeit, dass bis zu 70 Prozent aller Veränderungsprojekte nicht die Ziele erreichen, die sie sich gesteckt haben.
Auch die Gründe ähneln sich. Am häufigsten zitiert werden die acht Ursachen, die John Kotter in seinem Klassiker „Leading Change“ für das Scheitern von Change-Projekten verantwortlich gemacht hat. Zur Erinnerung: das Versäumnis, die Dringlichkeit der Veränderungsmaßnahme darzulegen, eine starke Führungskoalition zu bilden, eine Vision der Veränderung zu vermitteln, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, kurzfristige Erfolge systematisch zu planen sowie die zu frühe Verkündung des Abschlusserfolges und die ausbleibende Verankerung der Veränderungen in der Unternehmenskultur.
Die Unternehmensberatung BearingPoint kam bei der Befragung von 300 Schweizer Change-Verantwortlichen im Jahr 2021 auf sechs Handlungsfelder, in denen Fehler zum Scheitern von Veränderungsprojekten führen:
1 Kultur/Mentalität: Emotionaler Widerstand aufgrund mangelnden Verständnisses
2 Leadership: Mangelnde Führung und Unterstützung
3 Kommunikation: Fehlende Klarheit
4 Menschen/Fähigkeiten: Begrenzte Ressourcen und mangelndes Know-how
5 Struktur/Prozesse: Fehlende Ausrichtung auf Wandel
6 Umsetzung: Mangel an Vision, Strategie, Zielen und klar definierter Roadmap
Doch wovon berichten Projektleitende und Change-Verantwortliche im persönlichen Gespräch, wenn es darum geht, was die größten Fehler und Niederlagen ihrer Laufbahn waren? Und wenn, wie in diesem Fall geschehen, man ihnen bei Veröffentlichung absolute Anonymität zusichert? Folgende Beispiele und Erfahrungen kamen in den anonymen Gesprächen zutage.
Homeoffice-Einführung setzt nur auf Regeln
Person A berichtet von einer überstürzten Einführung von Remote Work im Zuge der Corona-Krise. „Da haben wir im Tagesrhythmus Verhaltensregeln, Durchführungsanweisungen und Techniktipps rausgehauen. Doch in den Köpfen lebte die Präsenzkultur weiter.“ Das habe natürlich bereits die Arbeit aus dem Homeoffice heraus überschattet – und zwar sowohl von Seiten der Führungskräfte, die um Kontrolle rangen, als auch von Seiten der Mitarbeitenden, die Leistungsnachweise höher gewichteten als Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Kein Wunder, dass nach Abklingen der Epidemie sofort wieder eine Präsenzpflicht eingeführt wurde.
Das aber hätte verhindert werden können. „Wir hätten das technische Einführungsprojekt einfach mit einem echten Veränderungsprozess begleiten müssen“, berichtet die Person. „Da hätte es genügt, die Remote-Erfahrungen zu reflektieren und mit Führungskräften wie Mitarbeitenden zu besprechen. Im Anschluss hätten wir entsprechende Kommunikationsskills und kooperative Führung schulen können – und die Welt sähe heute bei uns anders aus.“
Innovationsinitiative demotiviert im Bestandsgeschäft
Person B berichtet von einer großen Change-Initiative, die ein mutmaßlich träge gewordenes Familienunternehmen hin zu einer Innovationshaltung führen sollte. „Da haben wir die Leute mit Silicon-Valley-Narrativen überschüttet, Innovationsinseln gebaut, dort die Leute experimentieren und Geld verbrennen lassen – und noch dazu den Kolleginnen und Kollegen in einem immer noch sehr soliden Bestandsgeschäft suggeriert, sie hätten die Zeichen der Zeit nicht verstanden, sie seien zu träge, zu rückwärtsgewandt und ohnehin mehr oder weniger ein Auslaufmodell.“
Das führte natürlich im Bestandsgeschäft zu Frustration, riss Gräben auf und erzeugte Kämpfe um Anerkennung und Ressourcen. Auch erwies sich dieses Vorgehen als in keinster Weise hilfreich: Den Innovatoren fehlte die Rückkopplung in die Bestandsbereiche, die Innovationslust der Bestandsbereiche wurde ausgemerzt und führte zu Kündigungen oder innerer Emigration. „Dabei wäre es so einfach gewesen“, erzählt die Person. „Wir hätten nur den Gedanken der Ambidextrie leben müssen, nämlich dass es bei uns beides braucht: Exploration und Exploitation, Innovation und Effizienz. Und wir hätten beides wertschätzen und eine Durchlässigkeit zwischen den Bereichen ermöglichen müssen.“ In diesem Fall setzte sich Einsicht durch – und im genannten Sinne wurde, allerdings für viele zu spät, nachgesteuert.
Kommunikation, die keiner braucht
Person C berichtet: „Wir haben bei der Einführung eines wichtigen Teils einer Personalstrategie eine unglaubliche interne Kommunikation dazu aufgesetzt. Und uns dann gewundert, dass es scheinbar niemanden interessiert hat. Da waren wir einfach zu produktverliebt und haben viel Energie und Begeisterung in etwas gesteckt, was aus Sicht unserer Stakeholder überhaupt nicht von Relevanz war.“
Person D, die immer wieder als externe Kraft Change-Projekte begleitet, erzählte uns: „Ich habe ohne vorherige Stakeholderanalyse und Einschätzung der Gesamtsituation am Kick-off eines großen Projektes teilgenommen. Ein sachlicher Verweis von mir zu bestehenden Risiken hat dann unerwartet heftige Kritik losgetreten.“ Die geplante Veränderung war offenbar schon im Vorfeld sehr kritisch diskutiert worden. „Das hätte ich vorab recherchieren müssen. Es hat mir gezeigt, wie emotional auf Fakten reagiert wird und wie das objektive Urteilsvermögen in den Hintergrund rückt. Es wäre gut gewesen, die Situation im Vorfeld besser zu analysieren und die Risiken zu einem anderen Zeitpunkt und in einem anderen Rahmen anzusprechen.“
„Den Fuck-up-Kult sehe ich kritisch”
Wie umgehen mit Fehlern und Scheitern in Change-Prozessen? Professorin Ilka Heinze hat dazu eine klare Meinung.
Zu scheitern schmerzt und verunsichert, auch in Veränderungsprojekten. Wie sollten Change-Verantwortliche damit umgehen?
Zuerst möchte ich betonen: Ich halte die Verherrlichung des Scheiterns für naiv und gefährlich. Fuckup- Nights und andere Moden sehe ich eher kritisch. Denn Fehler zu machen und zu scheitern, hat Auswirkungen auf die Betroffenen, die mit lockeren Sprüchen und unreflektierten Gruppenevents nicht zu bewältigen sind.
Was macht denn Scheitern mit Menschen?
Ich habe dazu unter Gründern geforscht. Da bin ich auf vier grundlegende Arten gestoßen, mit dem Scheitern umzugehen. Dabei geht es immer darum, dem Scheitern einen Sinn abzugewinnen und im Idealfall aus den Fehlern zu lernen.
Wie würden Sie diese vier Arten beschreiben?
Da gibt es Personen, die das gründlich analysieren, emotional wenig an sich heranlassen und Sachgründe finden, warum das Vorhaben gescheitert ist. Auf der Basis können sie ihren Frieden damit machen, lernen aber für sich selbst eher wenig. Dann gibt es die, die unter dem Scheitern und den Folgen leiden. Die stecken im Loch und grübeln. Die sind zu Veränderungen und Schlussfolgerungen gar nicht in der Lage – zumindest noch nicht. Die dritte Art, mit Scheitern umzugehen, ist eher sportlich: Hinfallen gehört dazu, aufstehen und weitermachen. Diese Personen reden befreit über ihr Scheitern, entwickeln sich dabei aber als Person kaum weiter. Die vierte und beste Art damit umzugehen, legen jene an den Tag, die das Scheitern intensiv reflektieren, ihr Verhalten anpassen und ändern wollen. Sie gehen Projekte nicht nur deshalb an, um Erfolge zu erzielen, sondern auch, um zu lernen.
Einen Wandel nicht herbeizuführen, den ich herbeiführen sollte, wird aber Change-Verantwortlichen kaum verziehen. Was tun?
Da sehe ich zwei Ansatzpunkte. Erstens: Die Balance zwischen Minimierung der Fehlerquellen und dem Lernen aus dann doch gemachten Fehlern zu finden. Agile Herangehensweisen, die Projekte iterativ gestalten und damit auch Fehler und Möglichkeiten zu scheitern überschaubar halten, sind ein guter Weg. Dann braucht es aber auch eine andere Einstellung zu Veränderungsprojekten.
Welche wäre das?
Wir sollten ehrlicher sein. Veränderung ist ein komplexes Anliegen, hier sollten die Lernchancen für alle Beteiligten betont werden. Gerade bei gemeinschaftlichen Veränderungsprojekten können Sie ja nicht nur mit Typ 3 oder 4 die Veränderung betreiben. Da müssen alle ins Boot, und alle sollten das Nötige dabei lernen. Und alle müssen übrigens genauso konsequent verlernen, was an Verhaltens- und Herangehensweisen dem Neuen im Wege steht. Change-Manager sollten sich daher zunehmend auch als Lern- und Verlern-Coaches verstehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Randolf Jessl.
Autoren
Randolf Jessl
ist Geschäftsführer der Beratungsagentur Auctority. Er berät, trainiert und coacht an der Schnittstelle von Führung, Kommunikation und Veränderungsanliegen.
>>Randolf auf LinkedIn
Prof. Dr. Ilka Heinze
ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und Management an der Hochschule Fresenius. Sie hat zu Lernstrategien von gescheiterten Entrepreneuren promoviert.
>> Ilka auf LinkedIn
Jede Veränderung ist anders – auch ihr Scheitern. Dennoch lassen sich manche Ursachen für den Misserfolg besonders oft in Unternehmen beobachten. Im Beitrag „Warum Change häufig scheitert“ sind sieben Punkte für das Scheitern von Change.