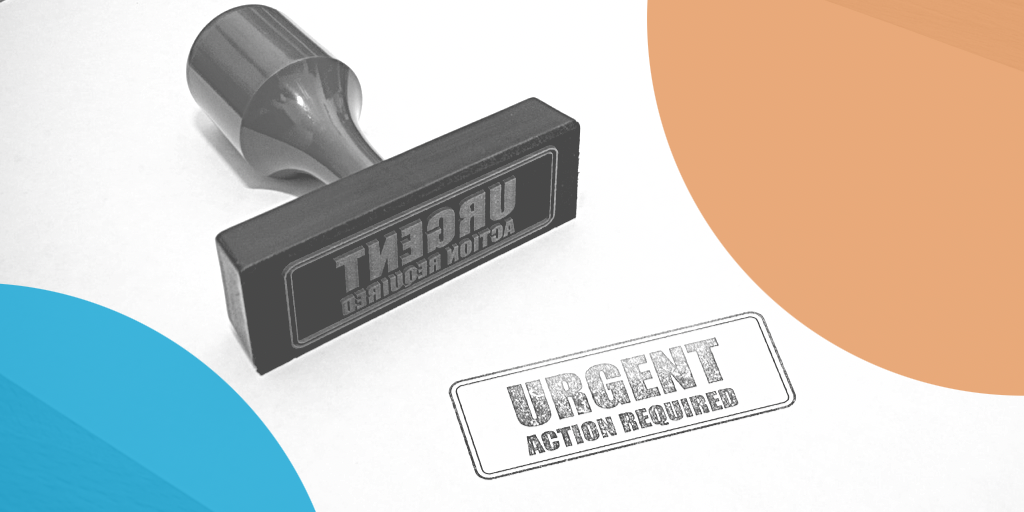Digitalisierung: Nicht an die Tristesse gewöhnen
Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes – das ist die Wahrheit – hängt stark an der Modernisierung und insbesondere Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Die Aussichten sind aber leider trüb – trotz der langsamen Fortschritte, die es durchaus gibt.
Alltag ist jedoch eher noch, dass wir zum Beispiel für den Personalausweis- und Reisepassantrag persönlich in der Behörde auftauchen müssen. Als mit Beginn des Ukraine-Krieges zahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wurden einem die Unzulänglichkeiten der Verwaltung hierzulande noch mal deutlich vor Augen geführt. Ukrainerinnen und Ukrainer können nämlich in ihrem Land fast alle Behördensachen online über das Mobiltelefon erledigen. In Deutschland hingegen ist das Wort „Behördengänge“ wörtlich zu nehmen. Wir assoziieren Verwaltung mit tristen, unübersichtlichen grauen Gebäuden, in denen man stundenlang sitzt und sehnlichst wartet, bis die eigene Wartenummer irgendwo aufblinkt. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen.
Eigentlich hätten die Behörden die meisten Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 gemäß des Onlinezugangsgesetzes bundesweit digital anbieten müssen. Sie haben es nicht geschafft.
Doch selbst wenn ein Prozess als vermeintlich digitalisiert abgehakt werden kann, sieht die Realität bei genauerem Hinsehen meist erbärmlich aus. Das beste Beispiel dafür sind die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Die BAföG-Leistungen können seit 2021 über eine Plattform digital beantragt werden. Allerdings sind die Probleme damit größer geworden. Es kommt zu erheblichen Verzögerungen bei den Genehmigungen. Die Anträge müssen nämlich von den zuständigen BAföG-Ämtern der Studierendenwerke ausgedruckt werden. Es wurde also nur die Antragstellung digitalisiert, die Prozesse dahinter nicht. Fehlendes Personal und zu wenig Papier intensivieren die Problematik.
An diesem Beispiel kann man gut erkennen, dass Digitalisierung oft nicht wirklich durchdacht erfolgt. Im Falle des BAföGs wurde nur der Teilprozess der Antragstellung betrachtet, „die Schauseite“. Es ging lediglich darum, die Vorgabe zu erfüllen.
Digitale Transformation zu gestalten, heißt jedoch, ganzheitlich zu denken und zu handeln. Das gilt sowohl für Behörden als auch Unternehmen. Bezüglich der Prozesse bedeutet ganzheitlich beispielsweise, die Prozesse nicht isoliert zu sehen, sondern end-to-end: Man fängt bei den Kunden an und hört bei den Kunden wieder auf – bis sie die angefragten Leistungen erhalten haben und zufrieden sind. Wer Digitalisierung vorantreiben will, sollte also die Gelegenheit nutzen, die Prozesse generell auf den Prüfstand zu stellen. Sind diese effizient und kundenzentriert?
Herausforderungen und Tätigkeiten der anderen
Und auch die Strukturen müssen entsprechend der End-to-end-Prozesse geprüft werden. Doch egal wie die Organisationsform letztlich aussieht: Erfahrungsgemäß gibt es ein enormes Potenzial bei der Gestaltung der Schnittstellen. Es wird meist zu wenig miteinander geredet und es gibt zu wenig Kenntnis über die jeweils anderen Bereiche.
Ganzheitlich denken und handeln betrifft viele Dimensionen: Anreizsysteme, Führung, Kultur und Kompetenzen sind ebenfalls wichtig bei der digitalen Transformation. Und nicht zuletzt braucht es die vernetzte Nutzung von Daten als Basis für kundenzentrierte Produkte und Dienstleistungen. Ein Riesenhindernis im öffentlichen Bereich.
Im Rahmen der Digitalisierung müssen einige Stellschrauben gedreht werden. Mit dieser Aufgabe lediglich einen Arbeitskreis zu betrauen, reicht nicht aus. Sowohl Behördenchefs und -chefinnen als auch CEOs müssen sich mit den ganzheitlichen Anforderungen einer digitalen Transformation auskennen und Verantwortung dafür wahrnehmen. Und sie müssen spätestens heute mit der Veränderung beginnen. [JCW]
Seit einigen Jahren verändern Informationstechnologien, Maschinen mit künstlicher Intelligenz und neue Medien nicht nur Märkte, Branchen und Geschäftsmodelle, sondern auch Produktionsprozesse und Kundenbeziehungen ebenso wie die Formen des Zusammenlebens und -arbeitens. Dr. Rainer Zeichhardt befasste sich im Beitrag „Kulturanalyse im digitalen Wandel“ damit.