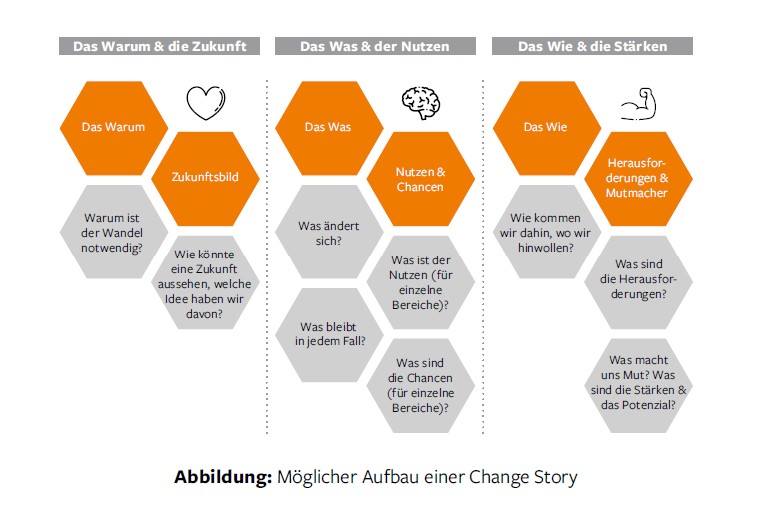Jetzt bloß nicht wegducken!
Als „ChatGPT“ plötzlich in aller Munde war, bekamen die Mitarbeitenden eines mittelständischen Unternehmens von ihrer Geschäftsführung folgende Mail: „KI (Künstliche Intelligenz) und entsprechende Tools haben seit einiger Zeit unser aller Aufmerksamkeit. Wir ermuntern alle, sich neugierig und offen mit den Möglichkeiten von KI zu befassen, Tools auszuprobieren und auch Vorschläge zu unterbreiten. Dabei sollte der sorgsame Umgang gleichzeitig oberste Priorität haben (…)“.
Zudem verwies die Geschäftsführung auf eine Guideline, die sich im Anhang der Mail befand, sowie auf eine extra eingerichtete Mailadresse, an die Mitarbeitende ihre Fragen rund um KI schicken konnten.
Als ich diese E-Mail zu Gesicht bekam, war ich beeindruckt. Augenscheinlich entschied sich die Unternehmensleitung – trotz aller Unsicherheiten – für einen offenen Umgang mit dem Thema Künstliche Intelligenz.
Natürlich wird KI schon seit Längerem in der Wirtschaftswelt eingesetzt. Aber bis zum Herbst 2022 ist der durchschnittliche Mitarbeitende eher nicht mit ihr in Berührung gekommen. Mit dem Aufkommen der „Generative Pre-trained Transformer“ (GPT)-Reihe von KI-Modellen hat sich das geändert. Nun kann KI auch den „normalen Büroangestellten“ die Arbeit erleichtern: zum Beispiel bei der Textverarbeitung, der Datenanalyse, der Recherche von Themen, bei der E-Mail-Kommunikation oder der Erstellung von Präsentationen.
Einen Rahmen setzen, um die Diskussion zu ermöglichen
Mit der Veröffentlichung von ChatGPT hat das Thema Künstliche Intelligenz in den Unternehmen einen unglaublichen Schub bekommen, gerade weil jetzt auch das Top-Management in den Organisationen hellhörig geworden ist. KI ist nun nicht mehr nur das Thema der IT-Nerds. Wirklich alle Fachexperten, die sich mit KI beschäftigen, sagen: Die Veränderungen der Arbeitswelt werden enorm sein.
Eine wesentliche Frage für alle Spitzenmanagerinnen und Unternehmenslenker muss deshalb sein, wie man die Mitarbeitenden an diese Veränderungen heranführt: Was müssen sie wissen? Wie fördert man die Neugierde für KI? Wie unterstützt man das spielerische Ausprobieren? Was braucht es, um die Zusammenarbeit von KI und Mensch bestmöglich zu gestalten? Wie adressiert man Ängste? Es geht jetzt darum, zumindest den Rahmen zu setzen, damit die Diskussion in den Unternehmen rund um KI möglich wird – und eben vielleicht auch das Ausprobieren und Lernen. Für fatal halte ich es, die Datenschutzproblematik, die es zweifelsohne gibt, vorzuschieben, um den Umgang der Mitarbeitenden mit KI gar nicht erst möglich zu machen.
Es gibt aber glücklicherweise schon heute eine Menge Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden an die KI-Technologie heranführen.
Die Berliner Stadtreinigung hat beispielsweise Ende September die „Future Work Week“ veranstaltet zum Thema „Digitales Arbeiten“, bei der es in den zahlreichen Sessions auch ganz viel um den Umgang mit Künstlicher Intelligenz ging.
Das Drogerieunternehmen dm hat im August mitgeteilt, dass es einen unternehmenseigenen KI-Chatbot für die Mitarbeitenden entwickelt hat. dmGPT bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie ChatGPT und nutzt die gleiche Technologie im Hintergrund. dmGPT läuft jedoch ausschließlich auf der dm-Infrastruktur. „Die Nutzerinnen und Nutzer können individuell Aufgaben an dmGPT abgeben, sei es die Bearbeitung von Texten, die Unterstützung bei der Programmierung, das Ausbessern von Programmfehlern oder die Erstellung von Konzepten.“
Ebenso hat Bosch ein eigenes KI-Sprachmodell angekündigt. BoschGPT soll unter anderem auf der Basis aller Informationen in der hauseigenen Datenbank den Mitarbeitenden Antworten geben. Bislang ist das Bosch-Wissen in der Datenbank nur über Schlagwörter auffindbar.
Solche unternehmenseigenen KI-Modelle werden mit Sicherheit zunehmen. Sie werden normale Werkzeuge für die Mitarbeitenden. Und das ist gut so. Denn so wird ein notwendiger Anfang gesetzt, damit sich die Mitarbeitenden mit den nächsten Entwicklungen leichter vertraut machen können. [JCW]
Ihre Meinung an chefredaktion@changement-magazin.de