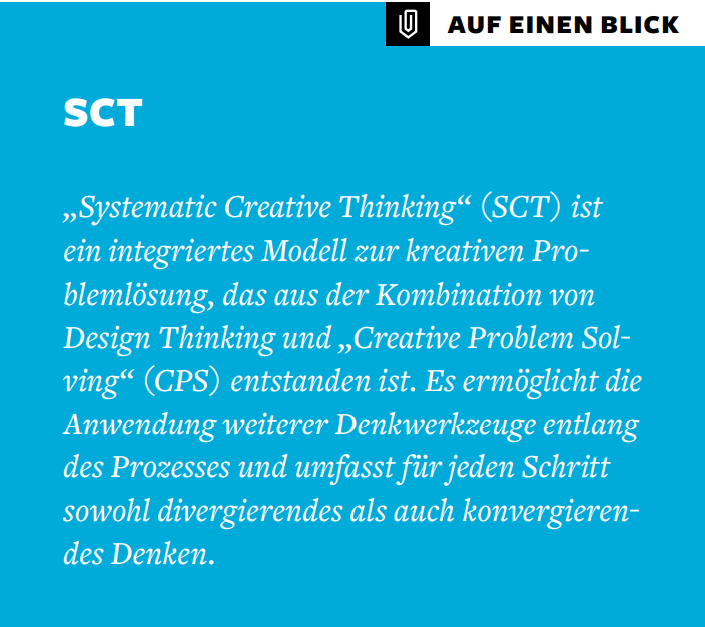Systematic Creative Thinking: Prozessmodell für Problemlösungen
Ein Navigationssystem für die kreative Problemlösung
Prozesse der kreativen Problemlösung in Gruppen sind nicht immer produktiv und schon gar nicht effizient. Oft enden gemeinsame Kreativ-Sessions darin, dass man sich vertagt und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ein Treffen vereinbart. Abhilfe kann hier ein Prozessmodell der systematischen Kreativität und der kreativen Problemlösung schaffen: Systematic Creative Thinking.
Systematic Creative Thinking (SCT) ist eine Art Navigationssystem sowohl für Einzelpersonen als auch besonders für Gruppen im Rahmen von Prozessen der kreativen Problemlösung und des innovativen Denkens. Situationen, die eine kreative Problemlösung erfordern, zeichnen sich dadurch aus, dass wir nicht wissen, wie eine Lösung zu einem Problem aussieht und/oder die bestehenden Ansätze nicht weiterhelfen. Das heißt, wir benötigen neue Ideen, um unser Problem zu lösen.
Als Problem wird dabei jede Situation bezeichnet, in der es eine wahrgenommene Lücke zwischen dem „Hier und Jetzt“ und der Situation gibt, die wir gerne haben möchten. Das sind sehr oft Situationen, für die Innovation relevant ist. Es kann sich aber auch um andere Kontexte handeln.
Beispiele sind:
- Es soll eine neue Werbekampagne für ein Produkt entstehen.
- Die Führungskraft möchte im Team ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft trotz Homeoffice und Corona schaffen.
- Das Management will den Einkaufsprozess der Organisation beschleunigen.
- Der Abrieb beim Bremsen des Zuges soll verringert werden.
- Die Anzahl der möglichen Ladezyklen einer Batterie soll erhöhen werden.
Alle Beispiele zeichnen sich dadurch aus, dass es nicht die eine offensichtliche, bekannte und funktionierende Lösung gibt. Stattdessen ist die Lösung des Problems noch unbekannt, oder aber eine den An sprüchen genügende Lösung noch nicht gefunden.
Eine Lösung überlegen und ausprobieren
In all den oben genannten Beispielen müssen wir kreativ sein, das heißt, uns eine neue Lösung überlegen und diese ausprobieren. Kreativprozesse sind von Natur aus nicht besonders effizient.
Der Grund ist, dass die funktionierende Lösung im Vorhinein nicht bekannt ist, auch wenn diese dann im Nachhinein oft „total logisch“ erscheint. Wir müssen also viele Richtungen erkunden und den Großteil dieser Erkundungen wieder abbrechen, bis wir eine Route gefunden haben, die im wahrsten Sinne des Wortes „gangbar“ ist. Besonders in Gruppen ist dieser Prozess nicht nur nicht effizient, sondern auch oft unproduktiv. Die beteiligten Menschen haben häufig implizite Vorstellungen davon, was die Gruppe als Nächstes machen sollte und es gibt meist kein gemeinsames explizites Vorgehen.
Genau hier setzen Prozessmodelle der kreativen Problemlösung im Allgemeinen und SCT im Speziellen an.
„Systematic Creative Thinking“ ist dabei eine Vereinigung von zwei bekannten und erforschten Modellen der systematischen kreativen Problemlösung. Es ist aus einem Bedarf in der Praxis heraus entstanden.
Zwei Prozessmodelle als Grundlage
Welche beiden Modelle haben wir zusammengefasst und warum?
Zum einen das relativ bekannte Design Thinking. Es kommt, wie der Name bereits andeutet, aus der Design-Branche und hat seine wissenschaftliche Heimat in der D-School der amerikanischen Stanford-Universität. Bekannt wurde Design Thinking durch die amerikanische Design-Firma IDEO, die das Design Thinking in dieser Form formalisiert und „beworben“ hat.
Beim Design Thinking stehen der Nutzer und dessen Bedürfnisse im Vordergrund.
Sie bilden den Ausgangspunkt aller Überlegungen. Der gesamte Prozess orientiert sich daran, Innovationen zu schaffen, die diese Nutzerbedürfnisse wirklich adressieren. Das „Problem“ von Design Thinking für die Praxis ist, dass es in vielen Unternehmen häufig Situationen gibt, in denen die Nutzerbedürfnisse nicht an vorderster Stelle stehen oder einfach nicht relevant sind für die Fragestellung, die wir kreativ lösen müssen. Wer beispielsweise den Abrieb von Bremsen verringern will, hat vermutlich nicht unbedingt den Fokus auf Bedürfnisse von Nutzern.
Das zweite Prozessmodell ist das außerhalb der Forschung relativ unbekannte Creative Problem Solving (CPS). CPS hat seine Anfänge in den 1950er-Jahren in Buffalo (USA). Initiator war Alex Osborn, der zu dieser Zeit das heute weltweit bekannte Vorgehen des Brainstormings entwickelte. Grundlage dafür waren seine Erfahrungen mit unproduktiven Besprechungen in der Werbeagentur BBDO. Nach einer Analyse mehrerer Tonbandmitschnitte dieser Besprechungen schlug er ein Vorgehen vor, das er Brainstorming nannte, bei dem die Entwicklung von Ideen von der Bewertung der Ideen getrennt wurde und bestimmten Regeln folgte.
Aufbauend auf dem Vorgehen des Brainstormings, das sich lediglich um die Entwicklung von Ideen kümmerte, formulierte Alex Osborn zusammen mit Sidney Parnes die erste Version des Creative-Problem-Solving-Modells, das den gesamten Prozess der kreativen Problemlösung beschreibt und damit auch die Schritte, die vor und nach der Ideenentwicklung geschehen.
CPS ist kontinuierlich weiterentwickelt worden und lässt sich im Gegensatz zum Design Thinking für alle Arten von Fragestellungen anwenden, die Kreativität benötigen. Allerdings ist es besonders für Menschen, die damit zum ersten Mal in Berührung kommen, nicht ganz leicht, da es relativ komplex ist. So gibt es zum Beispiel keine erkennbare Abfolge von Schritten. Dies ist zwar nahe an der Realität, wie Kreativprozesse in Gruppen oft ablaufen. Dennoch ist es für die meisten Menschen sehr hilfreich, wenn es eine Empfehlung für eine Reihenfolge bezüglich des Vorgehens gibt, wie zum Beispiel im Design Thinking.
In der Praxis haben wir daher immer öfter eine Mischung dieser beiden Prozesse genutzt und mit SCT ein integriertes Modell geschaffen, das sich stärker an den Kundenwünschen orientiert.
SCT zeichnet sich durch drei zentrale Elemente aus:
- Die Trennung des divergierenden und des konvergierenden Denkens
- Ein Prozessmodell als Strukturangebot
- Möglicher Einsatz sogenannter „Denkwerkzeuge“ entlang des Prozesses
Divergierendes und konvergierendes Denken trennen
In der Abbildung lässt sich erkennen, dass jeder Schritt im Prozess durch sich öffnende und schließende Pfeile umrahmt wird. Diese sich öffnenden und schließenden Pfeile symbolisieren zwei grundlegende Denkphasen im systematischen kreativen Denken: das divergierende Denken und das konvergierende Denken.
Divergierendes Denken bedeutet eine breite Suche nach vielen unterschiedlichen und neuen Alternativen. Alternativen können dabei beispielsweise Ideen, Informationen, Problemformulierungen oder Handlungsschritte sein.
Konvergierendes Denken beschreibt eine fokussierte, positive und bejahende Evaluation der Alternativen.
Die konsequente Trennung dieser beiden Phasen stellt das Grundprinzip des systematischen kreativen Denkens dar, ohne das Kreativprozesse und Denkwerkzeuge wertlos sind. Daher zeigt die Abbildung von SCT in jedem der Schritte die beiden Phasen des Denkens, die immer getrennt voneinander durchgeführt werden sollten.
Das Prozessmodell: von der Vision zum Plan
Einzelne Menschen folgen diesem Prozess oft auf natürliche Weise. Besonders für Gruppen ist es jedoch hilfreich, ein gemeinsames Bewusstsein dafür zu haben, in welchem Prozessschritt sie sich befinden. Und ob sie gerade divergieren oder konvergieren.
1. Vision formulieren
Hier geht es darum, ein lohnenswertes Ziel oder eine Herausforderung zu identifizieren, die dann kreativ bearbeitet werden soll. Oft gibt es bereits ein Ziel oder ein Problem, das vorliegt. In diesem Fall beginnt man direkt mit dem Schritt „Situation einschätzen“.
2. Situation erkunden
Hier geht darum, so viele Daten und Fakten wie möglich zu einem Thema zu sammeln, um ein besseres Verständnis für die Situation zu erlangen. Sobald das generelle Thema vorliegt, beginnen wir mit diesem Schritt.
2 a. Nutzer beobachten
Für den Fall, dass es sich um ein nutzerzentriertes Problem handelt, gibt es als Zwischenschritt oder Unteraspekt von „Situation erkunden“ die „Nutzerbeobachtung“, wie es besonders im Design Thinking praktiziert wird.
3. Herausforderungen formulieren
Ziel dieses Schrittes ist es, die Kernfragen für die Ideenfindung zu formulieren und damit die Stoßrichtungen für Innovation abzuleiten. Dabei werden die relevantesten Punkte aus dem zweiten Schritt als Grundlage genommen, um daraus zentrale Fragestellungen abzuleiten. Hier ist im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht nur analytisches Denken gefragt, sondern auch sehr viel Kreativität, um das Problem so zu formulieren und zu greifen, dass neue Lösungen überhaupt erst denkbar werden. Die Kernfragen werden dann meist in Form von offenen Fragestellungen formuliert. Zum Beispiel: „Wie könnten wir virtuell die Möglichkeit von spontanen Absprachen ermöglichen?“
4. Ideen erkunden
In diesem Schritt geht es darum, viele Ideen in Bezug auf definierte Kernfragen zu entwickeln. Dieser Schritt ist das, was die meisten Menschen mit Kreativität und Kreativitätstechniken assoziieren. Wie deutlich wird, gibt es allerdings Schritte, die davor und danach stattfinden (sollten).
5. Lösungen formulieren
Aus ersten Ideen müssen nun konkretere Lösungen werden. Es geht also darum, diese konkret werden zu lassen. Beim Ausarbeiten der Ideen zeigt sich dann oft, dass die ursprüngliche Idee etwas modifiziert werden muss, um umsetzbar zu werden. Dabei konzentrieren wir uns auf diejenigen Ideen aus Schritt vier, die das größte Potenzial haben.
6. Akzeptanz erkunden
Hier geht es darum, sowohl interne als auch externe Akzeptanz zu erkunden. Es werden zum einen (organisations-)interne Stakeholder und Entscheider betrachtet. Zum anderen schaut man gegebenenfalls nach außen, und zwar auf die Nutzer einer Lösung, um zu prüfen, ob die Lösung deren Bedürfnisse und Wünsche wirklich adressiert.
7. Plan formulieren
An dieser Stelle werden spezifische nächste Schritte festgehalten in Bezug darauf, was nun getan werden muss, um eine Lösung wirklich Realität werden zu lassen. Dazu wird ein kurzfristiger Handlungsplan erstellt: Wer hat was bis wann zu erledigen?
Längerfristige Aktionen können in einer Art Backlog landen, um dann bei Bedarf entsprechend priorisiert zu werden.
Einsatz von Denkwerkzeugen
In jedem dieser Schritte kann man sich bei Bedarf einzelner Denkwerkzeuge bedienen, die es erleichtern, die Ziele eines jeden Schrittes zu erreichen. Das können im vierten Schritt zum Beispiel verschiedene Werkzeuge zur Ideenfindung sein, wie „Erzwungene Verbindungen“ oder „SCAMPER“. Diese Werkzeuge sind optional, können jedoch das Navigieren durch den Prozess erleichtern und den Output steigern. Für jeden Schritt im Modell bieten sich unterschiedliche Werkzeuge an.
SCT orientiert sich an der natürlichen Art und Weise wie die meisten Menschen kreativ Probleme lösen. Seine besondere Stärke liegt darin, dass es implizite Annahmen explizit und damit für eine Gruppe greifbar und besprechbar macht. Dadurch können sich die Beteiligten immer wieder einmal auf die Meta-Ebene begeben, um zu reflektieren, welcher Schritt als Nächstes sinnvoll wäre.
Das Modell lässt sich sowohl in einem einzelnen Durchgang im Rahmen eines Workshops einsetzen als auch verteilt in kleinen Häppchen über einen längeren Zeitraum.
Der Zweck des Modells besteht immer darin, Einzelnen und besonders Gruppen Orientierung in einem kreativen Prozess zu bieten und den Prozess dadurch effektiver zu gestalten.
Autor
Florian Rustler
ist Mitgründer der creaffective GmbH. Er begleitet seine Kunden dabei, wirkungsvolle Zusammenarbeit in der Organisation zu gestalten. Er ist Autor von fünf Büchern zu den Themen systematische Kreativität, Innovation und agile Organisation. Literaturtipp: Florian Rustler (2020): „Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation. Das kleine Handbuch der Innovationsmethoden“, 10. Auflage, Midas Management Verlag AG. Das Buch enthält fasst 60 Denkwerkzeuge und ist neben Deutsch auch auf Englisch und Chinesisch erschienen.
»Florian bei Linkedin